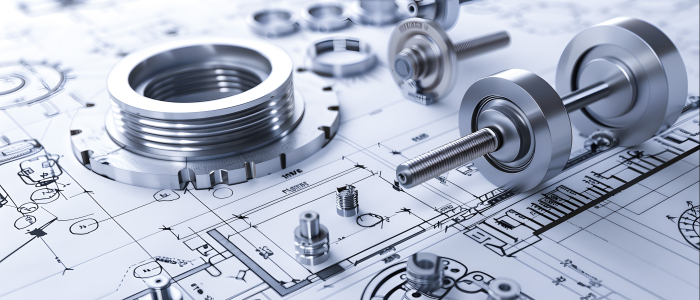
Das Einheitliche Patentgericht (EPG) hat sich rasch als beliebter Gerichtsstand in Europa etabliert. Der EPG-Report von Gleiss Lutz berichtet regelmäßig über diejenige EPG-Rechtsprechung, die für die Herausbildung des neuen einheitlichen Patentrechts und Patentprozessrechts in Europa am bedeutsamsten ist.
Zum zweijährigen Jubiläum des EPG fehlt es weiterhin an einer einheitlichen Äquivalenzlehre des EPG. Dafür verfestigt sich die „long-arm jurisdiction“ des EPG und das Berufungsgericht bestätigt die Zuständigkeit für Benutzungshandlungen vor Inkrafttreten des EPG.
Unser EPG-Report 06/25 behandelt folgende Themen:
- Auf dem Weg zur einheitlichen Äquivalenzlehre des EPG
- Berufungsgericht klärt Einzelheiten der Auskunftserteilung
- Keine Zahlung von Prozesskostensicherheit durch Verletzungsbeklagten und Nichtigkeitswiderkläger
- Zuständigkeit für Beklagtenmehrheit auch bei nur „mittelbarer“ Geschäftsbeziehung
- 24 Hilfsanträge können noch angemessen sein
- Berufungsgericht bestätigt Zuständigkeit für Benutzungshandlungen vor Inkrafttreten des EPGÜ
Keine „long-arm jurisdiction“ ohne entsprechenden Tatsachenvortrag
Auf dem Weg zur einheitlichen Äquivalenzlehre des EPG
Nach Auffassung der Lokalkammer Mannheim muss das EPG eine eigene Äquivalenzlehre entwickeln (Entscheidung vom 6. Juni 2025 - UPC_CFI_471/2023 – DISH ./. AYLO). Zu diesem Zweck könne das EPG die in den EPG-Mitgliedstaaten vertretenen Äquivalenzlehren bzw. Äquivalenztests vereinheitlichen. Nach dem Verständnis der Lokalkammer Mannheim ist eine äquivalente Patentverletzung nach sämtlichen Äquivalenzlehren bzw. Äquivalenztests der EPG-Vertragsmitgliedstaaten zu verneinen, wenn eine technisch-funktionale Äquivalenz des Austauschmittels in dem Sinne fehlt, dass die abgewandelten Mittel nicht im Wesentlichen dieselbe Funktion erfüllen, um im Wesentlichen dieselbe Wirkung zu erzielen („technisch-funktionale Äquivalenz“), s. zuvor schon Lokalkammer Brüssel, Entscheidung vom 17. Januar 2025 – UPC_CFI 376/2023 – OrthoApnea/Vivisol).
Diese Voraussetzung war im entschiedenen Fall nicht erfüllt. Die Lokalkammer konnte daher offenlassen, welche weiteren Prüfungsschritte eine einheitliche Äquivalenzlehre des EPG umfasst.
Die Lokalkammer Mannheim distanziert sich mit ihrem Ansatz vom Vorgehen der Lokalkammer Den Haag, die ein Prüfprogramm für die äquivalente Patentverletzung aus der niederländischen Patentrechtslehre übernommen hatte (dazu Lokalkammer Den Haag, Anordnung vom 22. November 2024 – UPC_CFI_239/2023 – Plant-e ./. Arkyne, dazu EPG-Report 12|24). Solange das EPG-Berufungsgericht keine einheitliche Äquivalenzlehre entwickelt hat, können die Parteien vor dem EPG die argumentativen Spielräume nutzen, die die divergierenden Äquivalenzlehren der
EPG-Mitgliedstaaten ihnen zur Verfügung stellen.
Berufungsgericht klärt Einzelheiten der Auskunftserteilung
Das Berufungsgericht hat Einzelheiten der Auskunftserteilung nach Art. 67 Abs. 1 EPGÜ geklärt und zudem die Auffassung der Vorinstanz bestätigt, dass ein Zwangsgeld auch Strafcharakter hat (Anordnung vom 30. Mai 2025 - UPC_CoA_845/2024 – Belkin ./. Philips). Aufgrund des Bestrafungsrisikos im Rahmen der EPG-Vollstreckung ist Auskunftsschuldnern nachdrücklich zu empfehlen, umgehend ab (spätestens) dem Zeitpunkt der Zustellung der Mitteilung über die Vollstreckungsabsicht eine ausreichende große Zahl von Mitarbeitern mit der Erstellung einer Auskunft zu befassen. Zudem ist Folgendes zu beachten:
- Für die Erteilung einer Auskunft ist in der Anordnung zur Auskunftserteilung eine Frist zu setzen, die im entsprechenden Klageantrag enthalten sein sollte. Fehlt es daran, ist es Sache des Auskunftsgläubigers, eine angemessene Frist zu setzen.
Für die Bemessung der Frist kommt es auf die Umstände des Einzelfalls an (insbes. Umfang der geschuldeten Auskunft, Zeitraum, über den Auskunft zu erteilen ist, und Ressourcen beim Auskunftsschuldner). Eine Frist von 14 Kalendertagen für eine Auskunft über einen Zeitraum von ca. acht Jahren erachtete das EPG-Berufungsgericht als zu kurz; angemessen seien sechs bis acht Wochen. - Ergibt sich aus der Anordnung zur Auskunftserteilung nicht, in welcher Form Auskunft zu erteilen ist, steht es dem Auskunftsschuldner grundsätzlich frei, die Auskunft wahlweise in Papierform oder in elektronischer Form zu erteilen.
- Soweit gemäß Art. 67 Abs. 1 lit. b) EPGÜ die Erteilung von Auskünftigen über die „Preise, die für die verletzenden Erzeugnisse gezahlt wurden“ angeordnet ist, sind regelmäßig sowohl die Hersteller- bzw. Einkaufspreise, als auch die Verkaufspreise mitzuteilen.
- Ein Zwangsgeld wegen nicht oder nicht rechtzeitig erteilter Auskunft kann auch dann noch verhängt werden, wenn die Auskunft zwischenzeitlich erteilt wurde.
Ein Zwangsgeld habe nicht lediglich Beuge- sondern auch Straffunktion.
Die Verhängung des Zwangsgelds setzte jedoch voraus, dass ein Verschulden des Auskunftsschuldners festgestellt werden kann, wobei der Auskunftsschuldner die Beweislast dafür trägt, dass eine rechtzeitige und ordnungsgemäße Einhaltung nicht zumutbar und/oder nicht möglich war. - Die Darlegungs- und Beweislast für die Behauptung, die Pflicht zur Auskunftserteilung sei (vollständig) erfüllt worden, liegt beim Auskunftsschuldner.
Die Bejahung des Strafcharakters führt zu einer mit Art. 82 Abs. 3 S. 2 EPGÜ schwer zu vereinbarenden Diskrepanz zwischen EPG-Vollstreckung und nationaler Vollstreckung (s. bereits den EPG-Report 01|25 zur Entscheidung der Vorinstanz (Lokalkammer München, Anordnung vom 17. Dezember 2024 – UPC_CFI_390/2023 – Philips ./. Belkin), die das Berufungsgericht jedoch nicht problematisiert hat.
Keine Zahlung von Prozesskostensicherheit durch Verletzungsbeklagten und Nichtigkeitswiderkläger
Das Berufungsgericht hat klargestellt, dass ein Verletzungsbeklagter keine Prozesskostensicherheit (Art. 69 Abs. 4 EPGÜ) zugunsten des Verletzungsklägers zu leisten hat (Anordnung vom 20. Juni 2025 - UPC_CoA_393/2025 - AorticLab ./. Emboline). Sinn und Zweck des Art. 69 Abs. 4 EPGÜ sei der Schutz eines Beklagten vor einem Kläger, der Klage erhebt, ohne über ausreichende Mittel zu verfügen, um den Beklagten zu entschädigen, falls der Kläger unterliegt. Diese Ratio finde auf einen Beklagten, der sich lediglich verteidigt, keine Anwendung. Damit hat das Berufungsgericht der Rechtsprechung der Lokalkammer München (Anordnung vom 16. April 2025 – UPC_CFI_628/2024 – Emboline ./. AorticLab) und der Lokalkammer Düsseldorf (Anordnung vom 3. Dezember 2024 – UPC_CFI_140/2024 – 10x Genomics ./. Curio Bioscience, dazu EPG-Report 01|25) eine Absage erteilt, die das Gegenteil vertreten hatte.
Das Berufungsgericht stellt weiter klar, dass ein Beklagter auch dann nicht nach Art. 69 Abs. 4 EPGÜ / R. 158 VerfO Prozesskostensicherheit leisten muss, wenn er in Reaktion auf die Verletzungsklage seinerseits Nichtigkeitswiderklage erhebt und so selbst zum (Nichtigkeitswider-)Kläger wird. Zwar spreche der Wortlaut des Art. 69 Abs. 4 EPGÜ für die Möglichkeit der Anordnung von Prozesskostensicherheit in diesem Fall. Die Verpflichtung zur Zahlung von Prozesskostensicherheit würde einen Verletzungsbeklagten und Nichtigkeitswiderkläger jedoch unverhältnismäßig in seiner Verteidigung beeinträchtigen, weil die Erhebung der Nichtigkeitswiderklage die einzige Möglichkeit ist, die Nichtigkeit des Klagepatents geltend zu machen. Demgegenüber kann der Nichtigkeitskläger im nationalen Verfahren vor dem Bundespatentgericht unter den Voraussetzungen des § 110 ZPO zur Zahlung von Prozesskostensicherheit verpflichtet werden.
Zuständigkeit für Beklagtenmehrheit auch bei nur „mittelbarer“ Geschäftsbeziehung
Nach Art. 33 Abs. 1 lit. b) EPGÜ kann eine Klage gegen mehrere Beklagte vor derselben Lokal- oder Regionalkammer des EPG erhoben werden, wenn einer der Beklagten (sog. Ankerbeklagte) seinen Sitz im Zuständigkeitsbereich der angerufenen Lokal- oder Regionalkammer hat. Voraussetzung ist unter anderem, dass zwischen den Beklagten eine Geschäftsbeziehung besteht. Die Lokalkammer München hat nun entschieden, dass eine „mittelbare Geschäftsbeziehung“ ausreiche (Anordnung vom 20. Juni 2025 – UPC_CFI_127/2024 – Headwater ./. Flextronics). Im entschiedenen Fall bejahte das EPG eine Geschäftsbeziehung zwischen dem inländischen Ankerbeklagten A und dessen ausländischen Konzernunternehmen B und C aufgrund der Konzernzugehörigkeit, sowie eine weitere Geschäftsbeziehung nur zwischen dem ausländischen Konzernunternehmen B und einem weiteren Unternehmen D, das keine direkte Geschäftsbeziehung zur Ankerbeklagten A unterhielt. Es sei ausreichend, dass die Geschäftsbeziehung zu anderen Gesellschaften des Konzerns besteht, dem die Ankerbeklagte angehört. Das EPG bezeichnet dies als „mittelbare“ Geschäftsbeziehung.
Die Entscheidung der Lokalkammer München bestätigt einmal mehr die Tendenz des EPG, die Zuständigkeitsregeln weit auszulegen. Es bleibt abzuwarten, ob das Berufungsgericht sich dieser recht weitgehenden Auslegung anschließen wird. Der Wortlaut des Art. 33 Abs. 1 lit. b) EPGÜ spricht eher dafür, dass ein und dieselbe Geschäftsbeziehung zwischen allen Beklagten erforderlich ist.
24 Hilfsanträge können noch angemessen sein
Die Lokalkammer Mannheim hat entschieden, dass die Vorgabe des R. 30.1c VerfO, wonach Hilfsanträge zur Verteidigung des Patents „den Umständen des Falls entsprechend von angemessener Zahl sein“ müssen, nicht rein formal zu prüfen ist (Entscheidung vom 6. Juni 2025 - UPC_CFI_471/2023 – DISH ./. AYLO). Entscheidend für die Beurteilung der Angemessenheit der Anzahl der Hilfsanträge sei die Begründung der Hilfsanträge. Dienten die Hilfsanträge in jeweils angemessener Zahl der Verteidigung gegen unterschiedliche Angriffe auf die Patentfähigkeit des Klagepatents, könnten auch 24 Hilfsanträge angemessen sein. Die Entscheidung ist zu begrüßen und unterstreicht, wie wichtig es ist, Hilfsanträge sorgfältig zu begründen und den unterschiedlichen Nichtigkeitsangriffen zuzuordnen.
Berufungsgericht bestätigt Zuständigkeit für Benutzungshandlungen vor Inkrafttreten des EPGÜ
Das Berufungsgericht hat entschieden, dass die Zuständigkeit des EPGÜ auch Benutzungshandlungen vor dem Inkrafttreten des EPGÜ und vor dem Rücktritt von einem etwaig erklärten Opt-Out umfasst (Anordnung vom 2. Juni 2025 – UPC_CoA_156/2025 – Esko ./. XSYS); zur Anordnung der Lokalkammer München vom 10. Februar 2025 – UPC_CFI_342/2024 – PHOENIX CONTACT ./. ILME s. EPG-Report 02|25). Die Frage, welches materielle Recht auf Handlungen anzuwenden ist, die sich vor dem Inkrafttreten des EPGÜ ereignet haben, ließ das Berufungsgericht ausdrücklich offen, da die Entscheidung einen Einspruch betraf. Die Lokalkammer Mannheim hat sich mit dieser Frage bereits auseinandergesetzt und danach differenziert, ob die Verletzungshandlung vor dem Inkrafttreten des EPGÜ abgeschlossen war (dann: nationales materielles Recht) oder nach dem Inkrafttreten des EPGÜ noch fortdauert (dann: grundsätzlich materielles Recht des EPGÜ) (Urteil vom 11. März 2025 – UPC_CFI_162/2024 – Hurom ./. NUC Electronics, s. dazu EPG-Report 03|25). Es bleibt abzuwarten, ob das Berufungsgericht diesem differenzierenden Ansatz folgen wird.
Keine „long-arm jurisdiction“ ohne entsprechenden Tatsachenvortrag
Die Lokalkammer Paris hat entschieden, dass das EPG auch für Klagen wegen Verletzung des polnischen Teils eines Europäischen Patents zuständig ist (Entscheidung vom 23. Mai 2025 – UPC_CFI 63/2024 – Hurom ./. NUC Electronics). Damit schließt die Pariser Lokalkammer sich der Rechtsprechung zur „long-arm jurisdiction“ der Lokalkammer Düsseldorf (Entscheidung vom 28. Januar 2025 – UPC_CFI_355/2023, dazu EPG-Report 01|25) und der Lokalkammer Mailand (Anordnung vom 8. April 2025, UPC_CFI_792/2024 – Alpinestars/Dainese, dazu
EPG-Report 04|25) an. Die Lokalkammer Paris stellt zwei Punkte klar: Die Frage der territorialen Reichweite der Entscheidung (Art. 34 EPGÜ) ist nicht im Wege des Einspruchs (R. 19 VerfO) geltend zu machen, sondern Gegenstand der Entscheidung in der Sache. Der Kläger trägt die Beweislast dafür, dass es zu konkreten Verletzungshandlungen im Gebiet des Nicht-EPG-Mitgliedsstaates gekommen ist.
Das Gericht erachtete den Vortrag, dass die Website der Beklagten europaweit abrufbar sei und europaweit Umsätze erzielen würde, als nicht ausreichend an, weil nicht vorgetragen worden war, dass der behauptete Umsatz mit dem Verletzungsprodukt (in Polen) erzielt worden war.
