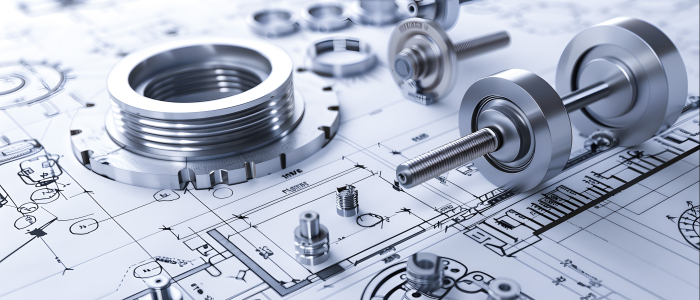
Das Einheitliche Patentgericht (EPG) hat sich rasch als beliebter Gerichtsstand in Europa etabliert. Der EPG-Report von Gleiss Lutz berichtet regelmäßig über diejenige EPG-Rechtsprechung, die für die Herausbildung des neuen einheitlichen Patentrechts und Patentprozessrechts in Europa am bedeutsamsten ist.
Die aktuellen Entscheidungen des EPG bestätigen, dass das Gericht Zuständigkeitsfragen und prozessuale Fragen pragmatisch und überwiegend klägerfreundlich handhabt. Zudem gibt es erste Klarstellungen zur angemessenen Entschädigung für die Benutzung veröffentlichter EP-Anmeldungen und product-by-process Patentansprüche.
Unser EPG-Report 04/25 behandelt folgende Themen:
- Long-arm jurisdiction der Lokalkammer am Sitz des Beklagten
- Keine Zuständigkeit des EPG für vor dem 1. Juni 2023 erloschene Patente
- Zuständigkeit einer Lokalkammer bei Beklagtenmehrheit
- Einspruch wegen unwirksamen Opt-In
- Product-by-process Ansprüche
- Entschädigung für Benutzung der offengelegten EP-Anmeldung
- Lokalkammer München wird Problem-solution-Test des EPA anwenden
- Beschlagnahme von Rechnungen und Lieferscheinen zu Zwecken der Beweissicherung
- Weites Ermessen der Lokalkammer bei Zulassung von Klage- und Parteiänderung
- Klageänderung im Verletzungsverfahren nach Antrag auf Änderung des Patents
- Nicht in jedem Fall Prozesskostensicherheit für Kläger aus China
Long-arm jurisdiction der Lokalkammer am Sitz des Beklagten
Im Anschluss an die Entscheidung BSH/Electrolux des EuGH vom 25. Februar 2025 (C-339/2022) hat die Lokalkammer Mailand entschieden, dass die vom EuGH formulierten Grundsätze auch für das EPG gelten (Anordnung vom 8. April 2025, UPC_CFI_792/2024 – Alpinestars/Dainese). Dementsprechend hat die Lokalkammer ihre umfassende Zuständigkeit zur Entscheidung über eine Verletzungsklage gegen eine in Italien ansässige Beklagte gemäß Art. 4 Absatz 1, 71a, 71b Brüssel Ia VO bejaht, und zwar einschließlich der Verletzung in EU-Mitgliedstaaten, die nicht am EPGÜ teilnehmen (hier: Spanien). Für diese sog. Long-arm-jurisdiction hatte sich die Lokalkammer Düsseldorf bereits vor der BSH/Electrolux-Entscheidung ausgesprochen (LK Düsseldorf, Entscheidung vom 28. Januar 2025, UPC_CFI_355/2023 – FUJIFILM/Kodak, s. dazu EPG-Report 1|2025). Da nach Auffassung des EuGH die Erhebung des Nichtigkeitseinwands die Wohnsitzzuständigkeit des Verletzungsgerichts unberührt lässt, stellt sich die Frage, ob das EPG das Verletzungsverfahren teilweise aussetzen kann oder muss, wenn in dem Drittstaat eine nationale Nichtigkeitsklage erhoben wird. Die EPG-VerfO adressiert diese Situation nicht.
Keine Zuständigkeit des EPG für vor dem 1. Juni 2023 erloschene Patente
Die Lokalkammer Mannheim hat mit Urteil vom 2. April 2025 (Entscheidung vom 2. April 2025 – UPC_CFI_365/2023 – FUJIFILM Corporation ./. Kodak) die Zuständigkeit des EPG für vor dem 1. Juni 2023 erloschene nationale Patente (einschließlich nationaler Teile von Europäischen Patenten) verneint. Etwaige Ansprüche aus solchen bereits erloschenen Patenten müssten vor nationalen Gerichten geltend gemacht werden. Das gelte gleichermaßen für EPGÜ-Mitgliedstaaten wie für EU-Staaten, die nicht dem EPGÜ beigetreten sind.
Steht der nationale Teil eines Europäischen Patents nach dem Start des EPGÜ noch in einem EPGÜ-Mitgliedsstaat Kraft, ist das EPG auch für dortige Verletzungshandlungen zuständig, die vor dem Inkrafttreten des EPGÜ am 1. Juni 2023 erfolgt sind, hat insoweit jedoch nationales Recht anzuwenden (Entscheidung vom 11. März 2025 – UPC_CFI_162/2024 – Hurom ./. NEC, s. dazu EPG-Report 3|25). Noch nicht entschieden hat die Lokalkammer Mannheim, ob dies auch für den noch in Kraft stehenden UK-Teil eines Europäischen Patenten gilt.
Nach der Auffassung der Lokalkammer Düsseldorf ist das EPG auch für Klagen wegen Verletzung eines noch in Kraft stehenden UK-Teils eines Europäischen Patents zuständig (Entscheidung vom 28. Januar 2025 – UPC_CFI_355/2023 – FUJIFILM Corporation ./. Kodak, s. dazu UPC-Report 1|2025). Es bleibt abzuwarten, ob auch die Lokalkammer Mannheim die „Long-arm-jurisdiction“ des EPG für UK bejaht. Die Überlegungen des EuGH in der Entscheidung BSH/Electrolux (C-339/2022) sind insoweit nicht unmittelbar anwendbar, weil UK kein Mitgliedstaat der EU ist.
Zuständigkeit einer Lokalkammer bei mehreren Beklagten
Die Lokalkammer München vertritt hinsichtlich der Anforderungen an den Gerichtsstand der Beklagtenmehrheit ein weites Verständnis des Art. 33(1)(b) EPGÜ: Im Fall eines Europäischen Patents liege „dieselbe Verletzung“ vor, wenn verschiedene Beklagte unterschiedliche nationale Teile eines Europäischen Patents durch das gleiche Erzeugnis oder Verfahren benutzten (Entscheidung vom 4. April 2025 – UPC_CFI_501/2023 – Edward Lifesciences ./. Meril). Nicht erforderlich ist danach, dass die Beklagten eine Verletzungshandlung gemeinsam begangen haben. Auch an die Darlegungslast der erforderlichen „geschäftlichen Beziehung“ zwischen allen Beklagten stellt die Lokalkammer geringe Anforderungen. Eine zwischen allen Beklagten in Bezug auf die Verletzungsform bestehende geschäftliche Beziehung scheint der Kläger nicht darlegen zu müssen; die Zugehörigkeit zu einer Unternehmensgruppe scheint auszureichen. Im konkreten Fall hat die Lokalkammer es als ausreichend angesehen, dass die in Deutschland ansässige Anker-Beklagte das „European Headquarter“ der Unternehmensgruppe war, woraus eine – nicht näher konkretisierte – Verantwortlichkeit gegenüber einem in Italien ansässigen Gruppenunternehmen abgeleitet wurde, das selbst nicht als Bezugsquelle der Verletzungsform in Erscheinung trat.
Einspruch wegen unwirksamen Rücktritts vom Opt-out
Die Lokalkammer Mannheim hat einen Einspruch (R. 19 VerfO) als unzulässig zurückgewiesen, mit dem die Beklagte die Unzuständigkeit des EPG wegen Unwirksamkeit des Rücktritts der Klagepartei vom Opt-out (Art. 83 (4) EPGÜ) geltend gemacht hatte (Anordnung vom 4. April 2025 – UPC_CFI_750/2024 – Samsung Electronics ./. Fingon).
Die Beklagte hatte die Unzuständigkeit des EPG wegen unwirksamen Rücktritts vom Opt-out damit begründet, dass die Klagepartei, die den Rücktritt vom Opt-out erklärt hatte, nicht die materiell berechtigte Patentinhaberin sei. Nach Ansicht des Gerichts ist über Tatsachen- und Rechtsfragen (hier: Patentinhaberschaft), die sowohl für die Entscheidung über die Zuständigkeit des EPG (hier: Wirksamkeit des Rücktritts vom Opt-out) als auch für die Entscheidung in der Sache (hier: Aktivlegitimation) relevant sind, nicht im Verfahren des Einspruchs, sondern im Hauptverfahren zu entscheiden. Dies liege auch im Interesse der Beklagten, weil eine Zurückweisung der Klage schon im Einspruch den Kläger nicht hindern würde, später auf Grundlage besserer Beweismittel erneut Klage zu erheben, eine Abweisung im Hauptverfahren aber schon.
In Fällen wie der entschiedenen Konstellationen ermöglicht R. 20.2 VerfO dem EPG über den Einspruch im Hauptverfahren zu entscheiden. Auf diese Regelung stellt die Lokalkammer allerdings nur hilfsweise ab.
Product-by-Process Ansprüche
Die Lokalkammer Düsseldorf hat zum Schutzumfang von Product-by-Process Ansprüchen festgestellt, dass das in Bezug genommene Verfahren nicht selbst Gegenstand des Schutzes sei und diesen nicht einschränke; maßgeblich sei die Realisierung derjenigen technischen Eigenschaften bzw. der erfindungsgemäßen Beschaffenheit, die dem Erzeugnis durch das Verfahren verliehen werden (Entscheidung vom 10. April 2025 – UPC_CFI_50/2024 – Yellow Sphere ./. Knaus Tabbert). Maßgeblich sei, wie die Fachperson die Angaben zum Herstellungsweg versteht und welche Schlussfolgerungen sie hieraus für die erfindungsgemäße Beschaffenheit der Sache zieht. Dem Verfahrensmerkmal komme „typischerweise“ die Aufgabe zu, die mit den sonstigen räumlich-körperlichen Merkmalen noch nicht unterscheidungskräftig umschriebene Sache weiter zu spezifizieren. Führt das Herstellungsverfahren zu Eigenschaften in dem Erzeugnis, die nur auf diesem Weg erreicht werden und deren Vorhandensein im fertigen Erzeugnis festgestellt werden können, sei der Schutzumfang auf Erzeugnisse beschränkt, die auf diesem Weg herstellbar sind.
Entschädigung für Benutzung einer offengelegten EP-Anmeldung
Die Lokalkammer Düsseldorf hat bestätigt, dass das EPG auch eine finanzielle Entschädigung wegen Benutzung einer offengelegten EP-Anmeldung zusprechen kann, Art 32 Abs. 1 lit f) EPGÜ (Entscheidung vom 10. April 2025 – UPC_CFI_50/2024 – Yellow Sphere ./. Knaus Tabbert). Die Entschädigung richtet sich nach dem nationalen Recht der EPÜ-Staaten, da Art. 67 EPÜ die Ausgestaltung des Schutzes, der mit der Veröffentlichung einer EP-Anmeldung verbunden ist, den Mitgliedsstaaten überlässt und weder das EPGÜ noch die EPatVO hierzu eine einheitliche Regelung enthalten. Insoweit hat der Kläger für jeden von der Klage umfassten EPÜ-Mitgliedsstaat darzulegen, dass die nationalrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, unter denen dort eine angemessene Entschädigung gewährt wird. Die Lokalkammer musste sich nicht mit der – wohl zu bejahenden – Frage befassen, ob diese „Mosaikbetrachtung“ auch in Bezug auf Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung anzuwenden ist (oder stattdessen die Entschädigung sich einheitlich nach dem gemäß Art. 7 Einheitspatent-VO anwendbaren Recht richten könnte).
Lokalkammer München wird Problem-solution-Test des EPA anwenden
Die Lokalkammer München hat erklärt, den Problem-Solution-Test, wie er vom EPA und den Beschwerdekammern praktiziert wird, im Rahmen der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit anwenden zu wollen, wobei das Gericht diese Absicht unter den Vorbehalt „soweit machbar“ stellt (Entscheidung vom 4. April 2025 – UPC_CFI_501/2023 – Edward Lifesciences ./. Meril). Dabei geht die Lokalkammer davon aus, dass der Test in der überwiegenden Zahl der Fälle zu demselben Ergebnis führen sollte wie die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nach dem vom Bundesgerichtshof entwickelten Grundsätzen. Bei beiden Prüfungen werde ein „realistischer Ausgangspunkt“ und eine Veranlassung der Fachperson verlangt, den „nächsten Schritt“ zu unternehmen, um die im Stand der Technik offenbarte Lösung so anzupassen, dass die Fachperson zur patentierten Lehre gelangt. Die Lokalkammer verspricht sich hiervon eine Angleichung der Rechtsprechung des EPG mit derjenigen der Beschwerdekammern des EPA, wobei sie nicht erläutert, in welchen Fällen der Vorbehalt greifen könnte, also eine Anwendung des Problem-Solution-Test nicht machbar sein sollte.
Beschlagnahme von Rechnungen und Lieferscheinen zu Zwecken der Beweissicherung
Ein Antrag auf Beweissicherung und Inspektion (Art. 60 EPGÜ) kann auch der Sicherung von Beweisen für einzelne Benutzungshandlungen dienen und auf die Beschlagnahme von Rechnungen und Lieferscheinen gerichtet sein, wenn ein entsprechendes Beweissicherungsinteresse besteht. Das hat die Lokalkammer Düsseldorf entschieden (Anordnung vom 16. April 2025 – UPC_CFI_539/2024 – Bekaert Binjiang Steel Cord ./. Siltronic et al.).
Die Beweissicherung und Inspektion sei insbesondere nicht auf die Ausgestaltung einer angegriffenen Ausführungsform beschränkt. Die Liste der möglichen Anordnungen des Gerichts (R. 196.1 VerfO) sei nicht abschließend. Es sei vielmehr im Einzelfall und vor dem Hintergrund des konkreten Beweissicherungsinteresses zu entscheiden, welcher Maßnahmen es bedarf. Im entschiedenen Fall habe der Verdacht von Verletzungshandlungen (unter anderem) in Deutschland bestanden; das Beweissicherungsinteresse habe sich daher auch auf Rechnungen und Lieferscheine bezogen, die dem Nachweis solcher Verletzungshandlungen dienten.
Weites Ermessen der Lokalkammer bei Zulassung von Klage- und Parteiänderung
Das EPG-Berufungsgericht hat unter Verweis auf das weite Ermessen der Lokalkammer umfangreiche Klageänderungen für zulässig erachtet (Entscheidung vom 11. April 2025 – UPC_CoA_169/2025 – Supponor ./. AIM Sport). Nach einem Einspruchsverfahren (vgl. EPG-Berufungsgericht, Entscheidung vom 12. November 2024 – UPC_CoA_489/2024 – Supponor ./. AIM Sport, dazu EPG Report 1|2025) hat die Klägerin eine angepasste Klageschrift (als Anlage mit einer Markup-Version) eingereicht, mit der erstmals zusätzlich Verletzungen in Deutschland und Spanien u.a. erstmals wegen äquivalenter Patentverletzung geltend gemacht werden. Zugleich hat die Klägerin ihre Klage auf eine weitere Gesellschaft aus dem Konzern der Beklagten erstreckt, die für die Verletzungen in Deutschland gemeinsam mit anderen Beklagten verantwortlich sein soll. Die Lokalkammer Helsinki hat sämtliche Änderungen zugelassen (Anordnung vom 11. Februar 2025 – UPC_CFI_214/2023 – AIM Sport ./. Supponor).
Das EPG-Berufungsgericht hat keinen Verstoß der Lokalkammer gegen das ihr eingeräumte weite Ermessen gesehen. Das Interesse an der Vermeidung eines zusätzlichen Rechtsstreits gegen die neue Beklagte mit evtl. widersprechendem Ergebnis rechtfertige die Zulassung der Parteierweiterung, auch wenn die Klägerin diese Änderung früher hätte vornehmen können. Dies gelte sogar dann, wenn die Klägerin selbst bereits zusätzliche nationale Verletzungsverfahren (gegen andere Konzerngesellschaften aus demselben Patent und denselben angegriffenen Ausführungsformen) eingeleitet hatte. Dabei stützte sich das Berufungsgericht insbesondere darauf, dass der Rechtsstreit (auch nach über eineinhalb Jahren) noch „am Anfang“ stand und es lediglich eine Klageschrift und ein abgeschlossenes Einspruchsverfahren (preliminary objection), aber noch keine weiteren Schriftsätze gab. Die Interessen der Beklagten seien dadurch gewahrt, dass sie erneut die vollen drei Monate zur Erwiderung auf die neue Klageschrift erhalten.
Die Entscheidung des Berufungsgerichts ist durch mehrere Besonderheiten und den angewandten eingeschränkten Überprüfungsmaßstab geprägt. Sie sollte nicht als Abkehr vom „front loaded approach“ des EPG missverstanden werden, lässt jedoch erkennen, dass das Berufungsgericht eine pragmatische Handhabung von Klageänderungen unterstützt.
Klageänderung im Verletzungsverfahren nach Antrag auf Änderung des Patents
Die Lokalkammer München hat klargestellt, dass eine Änderung der Verletzungsklage (R. 263 VerfO) zuzulassen ist, mit welcher die Klagepartei die in der Erwiderung auf eine Nichtigkeitswiderklage geltend gemachten (Hilfs-)Anträge auf beschränkte Verteidigung des Patents in das Verletzungsverfahren einführt (Anordnung vom 31. März 2025 – UPC_CFI_425/2024 – JingAo Solar ./. Chint New Energy Technology et al.). Es würde “keinen Sinn machen“ und stünde im Widerspruch zu R. 30.1(b) VerfO, wonach ein Antrag auf Änderung des Patents die Erläuterung enthalten muss, warum die geänderten Ansprüche verletzt sind, wenn es nicht möglich wäre, die geänderten Ansprüche zum Gegenstand des Verletzungsverfahrens zu machen.
Zugleich stellt die Lokalkammer München klar, dass ein (Hilfs-)Antrag auf Änderung des Patents (R. 30 VerfO) keinen unmittelbaren Bezug zu den in der Nichtigkeitswiderklage vorgebrachten Nichtigkeitsargumenten haben oder durch diese veranlasst sein muss. Es stehe dem Patentinhaber vielmehr frei, auch (Hilfs-)Anträge auf Änderung des Patents zu stellen, die nicht unmittelbar durch die Nichtigkeitsklage veranlasst sind.
Nicht in jedem Fall Prozesskostensicherheit für Kläger aus China
Die Lokalkammer Hamburg hat entschieden, dass eine Prozesskostensicherheit gemäß R.158 VerfO nicht allein deshalb gefordert werden kann, weil der Kläger in der Volksrepublik China ansässig ist (Anordnung vom 2. April 2025, UPC_CFI_429/2024 – JingAo Solar/Chint New Energy Technology u.a). Der bloße Verweis auf Zustellungsschwierigkeiten in China trotz Ratifikation des Haager Zustellübereinkommens sei nicht ausreichend und komme einer pauschalen Diskriminierung der Partei aufgrund ihrer Herkunft gleich. Damit distanziert sich die Lokalkammer Hamburg ausdrücklich von einer kürzlich ergangenen, im Ergebnis gegenläufigen Entscheidung der Lokalkammer München zwischen denselben Parteien (Anordnung vom 19. März 2025, UPC_CFI_425/2024 – Chint New Energy Technology u.a./JingAo Solar, UPC-Report 3|2025). Die Lokalkammer München hatte allein aufgrund der erfahrungsgemäß schwierigen Vollstreckung in China eine Prozesskostensicherheit angeordnet. Die Lokalkammer Hamburg verlangt eine eingehende, einzelfallbezogene Begründung.
